Die Geburt von Christins Sohn geht sehr schnell, der Kleine ist sehr pflegeleicht, die Nächte sind ok und ihr Mann kann sie gut unterstützen. Irgendwie fühlt sich Christin aber antriebslos und traurig, obwohl sie eigentlich ein sehr fröhlicher Mensch ist. Im Rahmen unserer Themenwoche Wochenbettdepression erzählt sie uns ihre Geschichte.
Allein in Deutschland sind jährlich mindestens 70.000 Frauen von einer Wochenbettdepression betroffen. Dennoch wird über das Thema wenig bis gar nicht gesprochen. Betroffene stehen häufig alleine da und haben Schwierigkeiten in ihrem Umfeld Akzeptanz für diese schwere Erkrankung zu finden.
Wochenbettdepression

In unserer Themenwoche auf Instagram haben wir postpartale Depressionen, wie Wochenbettdepressionen auch genannt werden, aus vielen Blickwinkeln beleuchtet. Dabei haben unsere Expertinnen Prof. Dr. Ditzen und Magdalena Zacher erklärt, was eine Wochenbettdepression ist, wie man sie erkennt und vieles mehr. Außerdem wurde die Hilfsorganisation Schatten & Licht e.V. vorgestellt und die Geschichte von Jessica, einer weiteren Betroffenen geteilt. Außerdem berichtete Prof. Dr. Kittel-Schneider wie auch Väter von depressiven Erkrankungen rund um die Geburt ihres Kindes betroffen sein können und zu guter Letzt haben wir einige Mythen rund um Wochenbettdepressionen aufgeklärt.
Christin, 42 Jahre alt und zweifach-Mama hat uns ihre Geschichte erzählt
Christin beschreibt sich selbst als offenen, lebensfrohen und gut strukturierten Menschen. Beruflich sehr erfolgreich und – wie man so schön sagt – mit beiden Beinen fest im Leben stehend, wird sie 2018 mit einem absoluten Wunschkind schwanger. Nach anfänglichen Turbulenzen verläuft diese erste Schwangerschaft gut und Christin kann sie sehr genießen.
Wie ging es dir nach der Geburt deines ersten Kindes?
„Noch auf dem Weg ins Krankenhaus hatte ich recht klare Vorstellungen oder Erwartungen, wie es ablaufen wird. Zum Beispiel, dass ich sicher erst noch ein bisschen spazieren gehen soll und am Ende schön das ganze Klinikgelände erkundet habe.“
Die Geburt geht dann vergleichsweise schnell. Für Christin, die wie sie selbst sagt, gerne klare Abläufe hat, zu schnell. Im Nachhinein, sagt sie, habe sie die Geburt „wie in Watte“ erlebt.
„Ich sollte ab einem bestimmten Zeitpunkt bei jeder Wehe „mitschieben“ und auf einmal war dann das Köpfchen schon da. Ich war total baff und wusste gar nicht mehr, in welcher Geburtsphase ich eigentlich war. Gefühlt hatte ich die beiden ersten Phasen einfach komplett übersprungen. Das hat mir schon während der Geburt irgendwie die Füße weggezogen…“
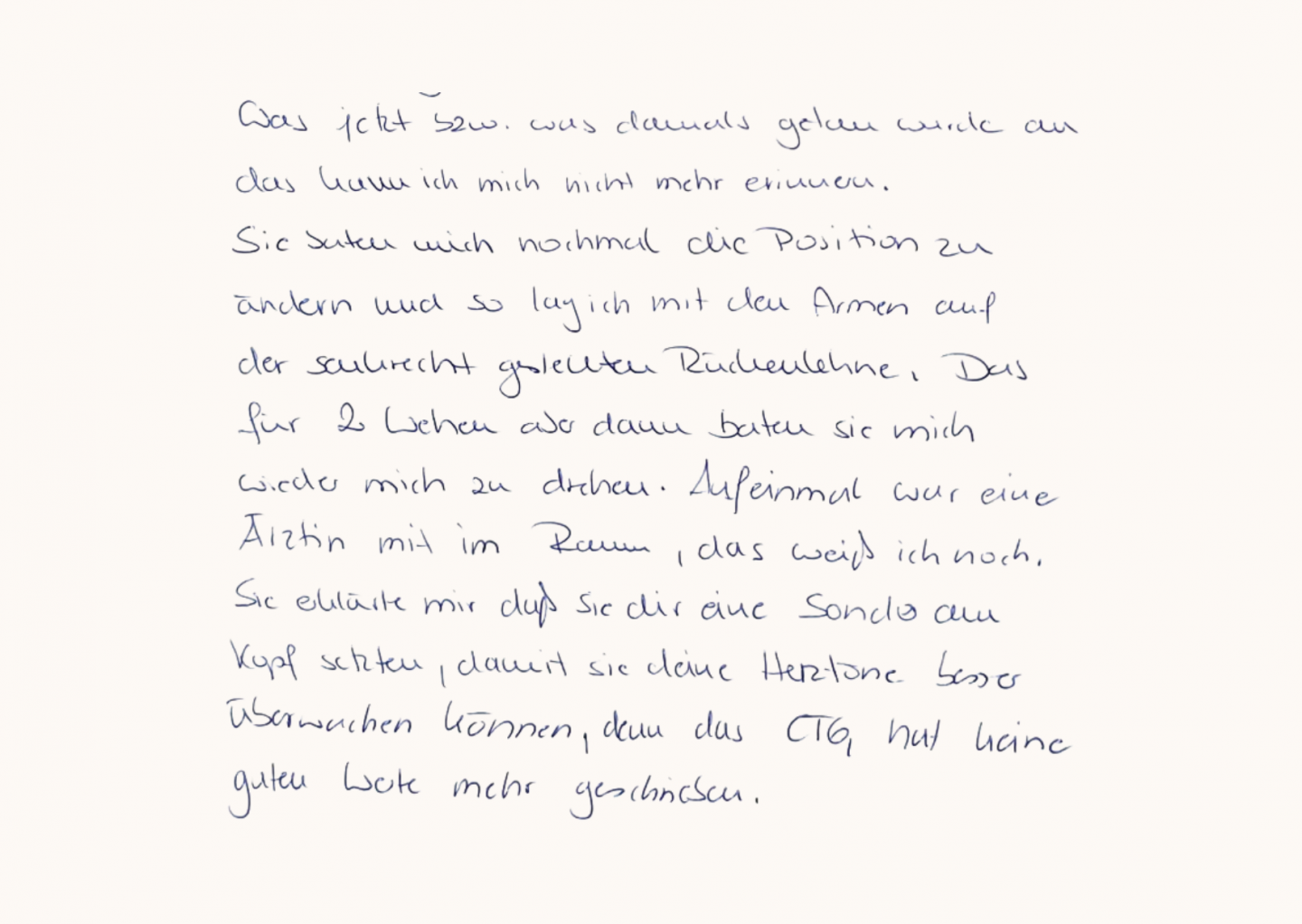
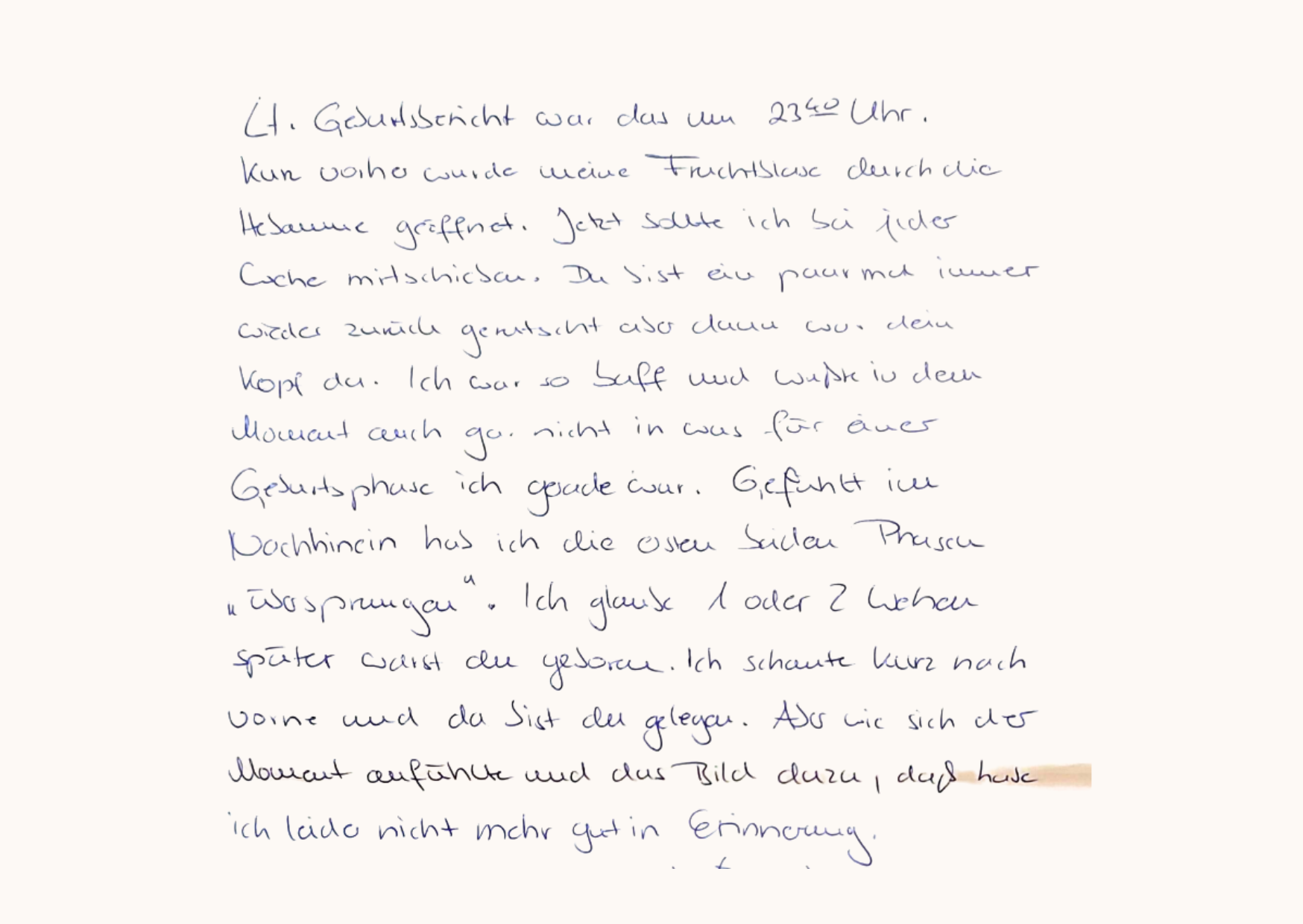
Das Baby war da und alles war – eigentlich – in Ordnung. Aber schon auf der Wochenstation hadert sie mit sich:
„Warum war das alles so schnell gegangen? Im Grunde konnte ich ja froh sein, dass ich mich nicht so lange durch die Geburt quälen musste. Aber ich hätte mir doch gewünscht, dass ich mehr Zeit habe. Ich habe da schon sehr mit mir gekämpft. Eigentlich wollte ich auch gar nicht entlassen werden, das ging mir alles einfach zu schnell.
Gleichzeitig wollte ich auch nicht zu lange mit dem Baby bonden, ich konnte das nicht. Aus Angst, wenn er zu lange bei mir ist, dann geht er nicht mehr weg und ich verliere meine Freiheit.“
Christin sagt, ihr Sohn war eigentlich recht pflegeleicht. Er hatte ein bisschen mit Bauchweh zu kämpfen, aber im normalen Rahmen. Das heißt, die Nächte waren okay und ihr Mann konnte sie gut unterstützen. Christins damalige Hebamme schiebt ihre Stimmung darauf, dass Hormone, die sonst über das Stillen ausgeschüttet werden, halt fehlten.
„Ich hatte mich gegen das Stillen entschieden, weil mein Mann und ich uns die Aufgaben und Verantwortung teilen wollten. Das hat auch gut funktioniert. Aber ich habe mich durch sie sehr verurteilt gefühlt und habe angefangen, mir Vorwürfe zu machen und mich schuldig zu fühlen, weil ich nicht gestillt habe.
Und ich habe gespürt, ich bin irgendwie traurig. Eigentlich bin ich nämlich ein fröhlicher Mensch, der viel lacht, und wir haben auch immer viel unternommen. Aber zu jenem Zeitpunkt wollte ich nicht vor die Tür gehen und ja, man kann sagen, ich habe mein Lachen verloren.“
Im Rückblick erinnert sich Christin gut an Situationen, die sie zusätzlich belastet haben, und beschreibt eindringlich, wie sie sich gefühlt hat:
Ich muss auch sagen, wir hatten gerade in der Anfangszeit viel Besuch und sind zum „Baby präsentieren“ schon nach vier Wochen in meine Heimat gefahren. Dass dabei ständig alle mitreden wollten und gute Ratschläge abgegeben haben, das hat mich zusätzlich runtergezogen. Dieses „Der Pulli macht ihn aber sehr blass“ oder „Ihr müsst ihn mal in den Fliegergriff nehmen“ oder auch immer wieder „Vielleicht hättest du doch stillen müssen“… Solche kleinen Sticheleien haben mir arg zugesetzt.
Ich habe viel geweint, so für mich. Ich hatte so ein Ritual, mit dem Kleinen zusammen Musik zu hören. Und bei manchen eigentlich schönen Passagen, musste ich immer weinen. Da habe ich mich schon gefragt, es kann doch nicht sein, dass diese Melodie mich so aus der Bahn wirft. Ich habe dann mein Baby angeschaut und gedacht, „Ich liebe dich, aber eigentlich will ich mein altes Leben zurück!“ Das habe ich so empfunden: Ich bin nicht mehr ich!
Ich hatte solche Momente, z.B. nachts, wenn ich zum Fläschchen geben aufstehen musste, dass ich die parkenden Autos gesehen habe, und mir dachte „Ich will morgen früh auch wieder ins Auto steigen und meiner Arbeit nachgehen, einfach Herr meiner Lage sein.“
„Ich weiß, ich habe meinen Sohn geliebt, aber ich konnte es nicht spüren.“
Ich konnte schon aufstehen und das Baby gut versorgen. Aber ich war immer sehr erleichtert, wenn mein Mann abends von der Arbeit heimkam und übernehmen konnte. Ich bin auch immer sehr viel spazieren gegangen, wirklich kilometerweit. Dabei konnte ich nämlich einfach für mich sein, war in diesem Moment mal nicht fremdbestimmt, weil das Baby schläft.
Gleichzeitig wollte ich nicht, dass mein Baby groß wird. Das klingt sicher seltsam, aber bei jeder U-Untersuchung wollte ich nicht, dass er wieder größer und schwerer geworden ist. Heute sehe ich auf Bildern, dass ich meinen Sohn in viel zu kleine Kleidung fast schon reingepresst habe. Und mich zum Beispiel auch geweigert habe, ihm etwas anderes anzuziehen als klassische Babystrampler. Das Loslassen fiel mir unglaublich schwer. Jeder Meilenstein, worüber sich andere Eltern gefreut haben, war wirklich schlimm für mich. Ich habe geweint, wenn ein neuer Zahn kam…„
Wann und wie hast du gemerkt, dass du eine Wochenbettdepression hast? Wie bist du letztendlich zu deiner Diagnose gekommen?
Christin erfährt, was nicht selten ist. Ihr Umfeld suggeriert ihr, es sei doch alles bestens und sie müsse doch froh und glücklich sein. Das Baby sei ja gesund, schlafe und entwickle sich gut. Und auch sie selbst schiebt den Gedanken an eine Wochenbettdepression erst einmal von sich:
„Ich hätte nie im Leben gedacht, dass mich das Thema jemals selbst betrifft. Ich bin problemlos schwanger geworden und wir haben uns riesig auf das Baby gefreut. Und auch auf die Geburt habe ich mir sehr gefreut. Und natürlich liest und hört man mal was über den „Babyblues“ und auch das Wort „Wochenbettdepressionen“ ist im Vorbereitungskurs mal gefallen, aber gesprochen wurde darüber nicht tiefergehend. Und ich selbst habe mir immer wieder gesagt, Mensch, du bist doch immer im Beruf so erfolgreich gewesen. Hast Vorträge und Schulungen gehalten, alles selbst gemanagt und hattest nie Probleme. Du hast doch keine Wochenbettdepression!
Irgendwann habe ich dann allerdings doch angefangen, zu recherchieren, wie lange der Babyblues normalerweise andauert. Gleichzeitig habe ich aber bei der Nachsorgeuntersuchung bei meinem Frauenarzt totgeschwiegen, wie es mir wirklich geht.
Mein Mann hat mich immer wieder vorsichtig darauf angesprochen, „Christin, dir geht es doch nicht gut, magst du nicht doch nochmal zu deinem Gynäkologen gehen und mit ihm sprechen?“ Ich habe immer abgeblockt, mich zurückgezogen und gedacht, es ist doch alles gut. Mein Mann hat im Nachhinein gesagt, er habe damals einfach nicht zu viel nachgebohrt, um mich nicht unter Druck zu setzen.“
Christin berichtet, ihr Glück war dann, dass eine Verwandte sie letztendlich doch direkt angesprochen hat.
„Sie ist selbst Gynäkologin und kannte auch den Geburtsverlauf und hatte mich immer bestärkt, dass doch alles gut verlaufen war usw. Aber als wir uns dann an Weihnachten gesehen haben und sie mich so hat erzählen hören, meinte sie, ich sollte nochmal mit meinem Frauenarzt sprechen und das alles auch ihm berichten. Daraufhin habe ich mal bewusst in mich hineingehört und festgestellt, ja, es geht mir nicht gut!
Dann war ich also wieder bei meinem Frauenarzt und – das werde ich nie vergessen – der musste mich nur anschauen und fragte direkt: „Ihnen geht es nicht gut, oder?“
Wie hat deine Behandlung ausgesehen und warum hast du dich persönlich für diese Form der Behandlung entschieden?
Christins Frauenarzt zögert nicht lange und überweist sie unmittelbar in eine örtliche Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie. Ein erstes Gespräch ergibt, dass eine stationäre Aufnahme nicht notwendig ist, aber es werden regelmäßige Therapiestunden vereinbart.
In der Klinik werden Christin auch Medikamente gegen die Wochenbettdepression verschrieben. Aber aus Sorge vor möglichen Nebenwirkungen nimmt sie diese nicht.
„Ich habe so viele Geschichten gehört… Ich hatte das Rezept in der Hand, aber ich habe mich nicht getraut, sie zu nehmen. Im Nachhinein würde ich sie sofort nehmen, eigentlich blöd, aber damals konnte ich das nicht. Ich hatte einfach Angst vor diesen Tabletten und ihren Nebenwirkungen.
Später habe ich dann auf Anraten der Klinik eine Therapeutin außerhalb der Klinik aufgesucht, um die Gesprächstherapie fortzuführen. Zu jenem Zeitpunkt, sagte diese Therapeutin dann, wäre es für die Medikamente zu spät. Jetzt wäre es Zeit, die Ursachen aufzuarbeiten. Eigentlich hätte meine Hebamme in den ersten Wochen nach der Geburt erkennen müssen, dass ich vom Babyblues in eine Wochenbettdepression abdrifte. Damals wäre der richtige Zeitpunkt für die Medikamente gewesen, um mich aus diesem Loch zu ziehen.“
Auf der Suche nach einer Therapeutin außerhalb der Klinik werden ihr Anlaufstellen genannt, über die sie Hilfe finden könne. Christin ruft die Webseiten auf – schließt sie aber direkt wieder.
„Aus Angst, was nun losgetreten werden könnte. Ich habe da zwei, drei Passagen gelesen und das war der blanke Horror. Das zu lesen, mich in so vielen Punkten wiederzuerkennen, hat mir erstmal den Boden unter den Füßen weggerissen.“
Schließlich findet Christin eine Therapeutin, mit der sie sich regelmäßig für Gespräche trifft. In diesen Gesprächen kommt dann auch das Gefühl in Bezug auf Christins Geburtserlebnis auf. Wie schwer die so schnelle und anders verlaufende Geburt noch auf ihr lastet.
„Es war ja so, dass ich damals die Zeit zurückdrehen, nochmal zurück in den Kreißsaal wollte, um die Geburt anders zu erleben. Mehr, wie ich sie mir vorgestellt hatte. Ich war ganz versessen darauf, von anderen die Geburtsberichte zu hören. Um mir dann zu sagen, 30 Stunden in den Wehen zu liegen, das hättest du doch gar nicht gewollt. Sei doch froh, wie es gelaufen ist. Aber ich konnte nicht mit dieser Geburt abschließen. Das hat mir immer noch so weh getan.
Wir haben vieles durchgesprochen und die Therapeutin hat mir Wege aufgezeigt, das Schöne und das Gute zu sehen. Ich musste das regelrecht erlernen.“
Wie ging es dir mit der offiziellen Diagnose Wochenbettdepression? Was hat dir in dieser Zeit geholfen mit deiner Diagnose umzugehen?
„Ich war erst einmal erleichtert. Einfach weil ich wusste, ich habe wirklich etwas, und jetzt wird mir geholfen. Mir tat gut, mit einer Person zu sprechen, die mich nicht kannte. Das hat es mir leichter gemacht, offen über alles zu sprechen. Auch die regelmäßigen Termine im Visier zu haben, dass ich dann wieder über meine Themen sprechen kann.“
Zusätzlich geholfen haben Hypnosesitzungen, die ihr eine Hebamme empfohlen hatte, die Christin zufällig kennengelernt hatte und die sie dann bis über das erste Lebensjahr ihres Babys hinaus betreut:
„Sie hatte selbst eine Wochenbettdepression und wir waren sofort auf einer Wellenlänge. Ich habe die Hypnose dann ausprobiert. Ich habe eigentlich alles ausprobiert, um wieder in die Situation im Kreißsaal zurückzukehren und sie noch einmal anders zu erleben. Obwohl ich ja eine schöne Geburt hatte – also eine für andere schöne Geburt – ICH wollte etwas anderes. Ich hatte drei bis vier Sitzungen, die mir sehr geholfen haben. Unter Hypnose habe ich tatsächlich die Geburtssituation noch einmal durchlebt und auch viel geweint. Aber das hat mir zusätzlich zu den Therapiestunden sehr gutgetan.“
Wie hat dein Umfeld reagiert?
„Das war zweigeteilt: Bei der einen Seite der Familie war und ist es eigentlich ein Tabuthema. Das ist eine ältere Generation, die diese Problematik nicht verstehen würde. Ich vermute, dass eher die Frage käme, was ich denn eigentlich hätte, weil mein Kind ja gesund ist, wir keine finanziellen Sorgen haben, ich einen Partner an der Seite habe, der seinen Teil der Verantwortung trägt, usw. Wenn wir dort waren, habe ich meine Gefühle irgendwie überspielt. Ich konnte und wollte darüber nicht reden.
Vom anderen Teil der Familie kamen immer viele gut gemeinte Tipps und Ratschläge in Bezug auf das Baby, was mich aber nur zusätzlich belastet hat. Das ging so weit, dass wir über meine Diagnose gesprochen haben, um zu erklären, warum ich gerade so bin wie ich bin, warum ich mich so verändert habe“. Da war dann mehr Verständnis da.
Meine Freundinnen haben toll reagiert. Wir haben viele offene Gespräche geführt. Und es gab letzten Endes viele Rückmeldungen, dass es ihnen auch oft nicht gut gegangen ist. Es spricht halt leider keiner darüber…“
Wie ist es dir in deiner zweiten Schwangerschaft ergangen?
Ursprünglich hatten Christin und ihr Mann gar nicht unbedingt ein zweites Kind geplant. Aber mit der Zeit kommt dann doch der Gedanke und der Wunsch nach einem zweiten Kind auf.
„Bei dieser Entscheidung hat ehrlich gesagt auch sehr stark mit hineingespielt, dass ich noch einmal gebären kann. Es war mir wichtig, noch einmal eine Geburt zu erleben, die anders verläuft. Ich wollte an diese erste Geburt, „diese graue Wolke“, einen Haken setzen.
Natürlich hatte ich auch Sorge, ob es mit dem zweiten Kind wieder so wird. Aber dann hatte ich großes Glück, ich hatte die bestmögliche Begleitung durch meinen Frauenarzt und meine Hebamme (diejenige, die ich damals kennengelernt hatte). Und auch das Klinikpersonal bei der Geburt war informiert und alle sind sehr gut auf mich eingegangen.
Meine größte Angst war, dass ich wieder in ein Loch falle. Und meine Therapeutin hat mir auch gesagt, dass ich davor nicht gefeit bin. Aber ich war bei der zweiten Geburt mental ganz anders vorbereitet. Ich habe mich selbst besser gekannt und z.B. auch von meinem Mann eingefordert, früher zu sagen, wenn es wieder in die falsche Richtung läuft.
Auch meine Hebamme hat mich toll begleitet, war ganz oft da. Sie hat mir auch den Tipp gegeben, Tagebuch zu schreiben, um auch rückblickend besser nachvollziehen zu können, wie es mir ging und geht. Auch die Therapie habe ich noch ein paar Monate fortgesetzt.
In Absprache mit der Hebamme wurden mir auch vorab für den Fall der Fälle schon Medikamente verschrieben, die lagen quasi griffbereit im Schrank.
Christins zweite Geburt verläuft am Ende auch vergleichsweise schnell, aber sie kann den ganzen Weg dorthin bewusster erlebt. Kann klarer formulieren, was ihr wichtig ist, z.B. direkt untersucht zu werden, um zu wissen, an welchem Punkt, in welcher Phase der Geburt sie sich befindet.
„Beim wöchentlichen Check bei meinem Gynäkologen wurde festgestellt, das Fruchtwasser abging. Daraufhin wurde ich sofort in der Klinik aufgenommen. Ich hatte Wehen, spürte diese aber nicht. Was wirklich toll war: Jede Hebamme, die da war, fragte mich, was bei der ersten Geburt „schiefgelaufen“ sei und hat auf all das besonders Rücksicht genommen. Da hatte ich das Gefühl „Und jetzt bin ich in meiner Geburt!
Obwohl die Geburt an sich keine 30 Minuten gedauert hat, war es für mich dieses Mal perfekt, da ich schon zwei Tage vorher im Klinikum war und ich es für mich so empfand, dass ich ab dann unter der Geburt war.
Anschließend konnte ich mit meinem zweiten Baby auch stundenlang bonden. Ich konnte und wollte es! Die ersten 8 Wochen mit dem Baby täglich 2-3 Stunden Haut an Haut dazuliegen, das hat mir extrem geholfen. Diese Stunden mit ihr waren einfach magisch und haben mir viel Kraft gegeben. Ich bin nicht mehr in dieses Loch abgerutscht, weil ich besser auf mich selbst gehört habe und ich so eine gute Betreuung hatte. Alle wussten, was ich wollte, auch weil ich offen damit umgegangen bin und es klar ausgesprochen habe, was ich brauche.“
Wie geht es dir heute und was möchtest du unseren Leser*innen noch mitgeben?
„Mir geht es gut. Ich habe immer wieder auch Phasen, in denen es mir nicht so gut geht. Manchmal trauere ich der ersten Geburt noch nach, aber ich würde sagen, ich habe unterm Strich gut damit abgeschlossen.
Als erstes fände ich wichtig, das Thema „Wochenbettdepressionen“ schon im Geburtsvorbereitungskurs viel klarer anzusprechen. Also über die Hormonumstellung und den Babyblues hinaus darüber aufzuklären.
Meine Empfehlung an andere Eltern ist: Wenn man nach der Geburt das Gefühl hat, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, man oft traurig ist, dass man dann offen darüber spricht. Dass man sich schnell Hilfe sucht, mit dem/der Gynäkolog/in oder der Hebamme spricht. Dass man sich nicht verstellt, erst gar keine Mauer um sich herum aufbaut. Es ist so wichtig, darüber zu sprechen. Und sich zu trauen, Medikamente zu nehmen!
Nehmt euch Zeit! Versucht, euch nicht unter Druck setzen zu lassen. Die heile Welt, die man sich vorstellt, ist oft nur Schein. Das Leben dreht sich komplett, man ist sehr fremdbestimmt. Darum ist es wichtig, erstmal anzukommen.
Heute weiß ich, dass es ein Fehler war, sich nicht mehr Zeit für sich und die kleine Familie zu nehmen. Und, dass es umgekehrt wirklich wichtig ist, das Wochenbett Zuhause, wirklich im Bett oder auf dem Sofa zu verbringen.“
Liebe Christin, ganz herzlichen Dank für deine Offenheit und dein Vertrauen, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Wir wünschen dir und deiner Familie alles Gute!
Weitere nützliche Infos rund um euer Baby
Wo finden Betroffene Hilfe?

Schatten&Licht e.V. ist eine deutschlandweite Selbsthilfeorganisation und Anlaufstelle bei Wochenbettdepressionen. Der Verein ist ehrenamtlich organisiert und hilft Betroffenen und Angehörigen von peripartalen Depressionen. Hier erhalten Frauen Listen mit Ansprechpersonen in ihrer Nähe und haben Zugriff auf ein breites Netzwerk an Betroffenen und können Ehrfahrungsberichte von anderen lesen. Außerdem gibt es erste Selbsthilfemaßnahmen und einen Selbsttest für sofortige Hilfe. Darüber hinaus gibt es Informationsmaterial und Tipps für Angehörige, wie sie die Mutter am besten unterstützen können und auch selbst Hilfe finden.
ABOUT

Wir sind Anja & Marie, zwei Hebammen aus Leidenschaft.
In Deutschland herrscht derzeit ein großer Mangel an Hebammen. Dieses Problem bekommen wir nahezu täglich in unserer Arbeit zu spüren. Viele Familien fühlen sich gerade in dieser besonderen Zeit mit ihren Fragen rund um die Schwangerschaft, das Wochenbett und ihrem Kind allein gelassen.
Daher haben wir uns entschieden, dir bei all deinen Problemen unterstützend mit unserem Blog zur Seite zu stehen, damit du alles nachlesen und loswerden kannst, was dich und dein Kind betrifft.
Viel Spaß beim Lesen!
FOLGE UNS AUF DEINER LIEBLINGS-PLATTFORM













